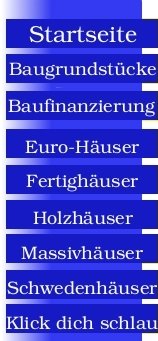|
|
|

Spiralförmige
Energiekörbe sind eine weitere Alternative, Erdwärme
zu nutzen. Diese werden in Vertikalbohrung oder in Gräben in
etwa 2 bis 4 Meter Tiefe in den Boden eingebracht. Der Abstand
zwischen den Körben beträgt ca. 4 Meter.
|
|

Erdwärmekollektoren
werden horizontal ca. 20 cm unterhalb der Frostgrenze verlegt. In
der Praxis sind dies meist ca. 1,0 bis 1,4 m Tiefe. Wie groß
ein Erdwärmekollektor sein muss, hängt vom Wärmebedarf
des Gebäudes und den Speichereigenschaften des Erdreichs ab,
aber darum kümmert sich der Fachmann.
Erdwärmesonden,
Energiekörbe und Erdwärmekollektoren haben eine
Lebensdauer von mindestens 100 Jahren.
|
|
Genehmigung
Bei
Planung und Bau von erd-gekoppelten Wärmepumpen sind in
Deutschland die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und
die wasserrechtlichen Regelungen bzw. die Wassergesetze der Länder
zu beachten.
Werden Erdwärmesonden oder Energiekörbe
eingesetzt, kann je nach Bundesland und Bodenbeschaffenheit ein
Genehmigungsverfahren erforderlich sein. Außer in
Wasserschutzgebieten ist der Einsatz von Erdwärmesonden
grundsätzlich überall erlaubt. Dienen
Erdwärmekollektoren als Wärmequelle, genügt meist
eine Anzeige bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde.
Der geschulte Wärmepumpen-Installateur weiß, was zu tun
ist.
|
|
Wärmequelle
Wasser

Die
Temperatur von Grundwasser beträgt selbst an kältesten
Tage zwischen 7 und 12 °C. Über einen Förderbrunnen
wird das Grundwasser entnommen und dem Verdampfer der Wärmepumpe
zugeführt, der dem Wasser die Wärme entzieht. Das um ca.
5 °C abgekühlte Wasser wird anschließend in einen
Schluckbrunnen zurückgeführt. Wichtig ist, dass die
Wasserqualität den Erfordernissen genügt. Zwischen
beiden Brunnen sollte ein Abstand von etwa 10 bis 15 Metern
eingehalten werden.
|
|
Genehmigung
Das
Vorhaben muss in Deutschland von der zuständigen Behörde
(Landratsamt) genehmigt werden.
Die Zustimmung kann an
bestimmte Auflagen gebunden sein. Soweit für Gebäude ein
Anschluss- und Benutzungszwang an eine öffentliche
Wasserversorgung besteht, ist eine Genehmigung der
Grundwassernutzung als Wärmequelle durch die Gemeinde
erforderlich.
Außer in Wasserschutzgebieten ist die
Nutzung von Grundwasser grundsätzlich überall
erlaubt.
Die Bohrfirmen wissen bestens Bescheid und helfen
Ihnen bei den erforderlichen Maßnahmen oder übernehmen
diese ganz.
|
|
Wärmequelle
Luft

Luft
gibt es überall. Sie kann als Wärmequelle ohne großen
baulichen Aufwand erschlossen werden. Ventilatoren führen die
Außenluft am Verdampfer der Wärmepumpe vorbei, wobei
ihr Wärme entzogen wird. Da mit fallender Außentemperatur
die Leistung der Wärmepumpe nachlässt, unterstützt
ein Elektro-Heizstab die Wärmepumpe an den wenigen wirklich
sehr kalten Tagen des Jahres.
Luft/Wasser-Wärmepumpen
gibt es in
|
|

drei
charakteristischen Bauformen:
- Kompaktwärmepumpen für
die Außenaufstellung
- Kompaktwärmepumpen für
die
|
|

Innenaufstellung
-
Splitwärmepumpen mit einem Innen- und Außenteil
Die
Nutzung der Wärmequelle Luft ist genehmigungsfrei.
|